 Bildrechte: Dr. Königstedt - BRV
Bildrechte: Dr. Königstedt - BRVTalsand, Binnendünen und Moore
Charakteristisch für das Elbetal sind die Binnendünen. Die überwiegenden Nordwestwinde trugen nach der Eiszeit die feinkörnigen Sande aus der damals unbewachsenen Talsohle fort. An Geländekanten und dem Rand des Urstromtals lagerten sie sich ab und türmten sich bis zu 30 m hoch auf. Der größte Dünenzug befindet sich heute östlich der Elbe zwischen Neuhaus und Dömitz.
Während die grundwassernahen Talsandflächen teilweise auch ackerbaulich genutzt werden, sind die trockenen, sehr armen Dünenstandorte naturnah erhalten geblieben. Bis ins 19. Jahrhundert wanderten die fast unbewachsenen Dünen mit dem Wind. Nach umfangreichen Aufforstungsmaßnahmen sind sie heute überwiegend mit Kiefern und Sandbirken im kleinflächigen Wechsel mit Sand-Magerrasen bestanden. Nur an wenigen Stellen sind die Dünen heute noch in Bewegung, wie beispielsweise im Bereich der Stixer Wanderdüne. Solche Extrem-Standorte bieten für einige hoch spezialisierte Tier- und Pflanzenarten geeignete Lebensbedingungen. Zu ihnen gehören der Ameisenlöwe, der seine Fangtrichter in den lockeren Dünensand baut, oder die Ödlandschrecke. Die im Elbetal heimischen Kreuz- und Knoblauchkröten graben sich in den lockeren Sandboden ein, um hier Sommerhitze und Winterkälte zu überstehen.
Im Windschatten der Dünen haben sich in Ausblasungsmulden kleinflächig Moore entwickelt. In der Vergangenheit nutzte man sie für die Torfgewinnung, heute sind sie Rückzugsräume für bestandsgefährdete, moortypische Arten. Der Erhalt der Moore im Elbetal ist jedoch durch den Rückgang der Niederschläge, bedingt durch langfristige Klima- und Umweltveränderungen, stark gefährdet.
 Bildrechte: Dr. Königstedt - BRV
Bildrechte: Dr. Königstedt - BRVArtikel-Informationen
erstellt am:
18.05.2005
zuletzt aktualisiert am:
06.05.2010

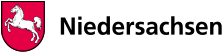

 english
english